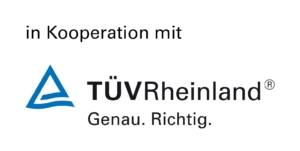Kontroverse um das LkSG: Entlastung für Unternehmen oder Entkernung der Sorgfaltspflicht?
Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), ein wichtiges Instrument zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in globalen Lieferketten, steht erneut im Zentrum der Debatte. Am 3. September 2025 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur „Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes – Entlastung der Unternehmen durch anwendungs- und vollzugsfreundliche Umsetzung“ beschlossen. Damit sollen deutsche Unternehmen, insbesondere der Mittelstand, entlastet und Bürokratie abgebaut werden.
Geplant ist unter anderem, dass Berichtspflichten entfallen und Unternehmen erst bei schweren und systematischen Verstößen mit Sanktionen rechnen müssen. Dazu hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine neue Auslegungshilfe zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz veröffentlicht. Verstöße können demnach auch dann geahndet werden, wenn keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden – selbst ohne bereits eingetretene Verletzung.
Positive Stimmen: Bürokratieabbau und Wettbewerbsfähigkeit
Die Bundesregierung und Wirtschaftsverbände begrüßen die Anpassungen ausdrücklich. Das Bundesarbeitsministerium argumentiert, dass zur Entlastung des Mittelstands die Senkung der Dokumentations-, Nachweis- und Berichtspflichten und der Sanktionen notwendig sei. Zudem sollen doppelte Berichtspflichten mit Blick auf die künftige EU-Richtlinie CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) vermieden werden. Sie muss bis Juli 2027 in nationales Recht umgesetzt werden. Zentrale Botschaft: „Die Wirtschaft braucht Rechtssicherheit, keine Doppelbelastung.“
Auch das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt die Reform, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu sichern. Der bisherige bürokratische Aufwand benachteilige Deutschland im Vergleich zu Nicht-EU-Staaten.
Selbst Teile der Opposition wie die FDP schließen sich diesen Argumenten an und warnen, ein Lieferkettengesetz dürfe kein Bürokratiemonster sein. Sie befürchten, dass übermäßige Regulierungen die Innovationskraft und den Exportmarkt behindern. Wirtschaftsverbände wie der BDI sehen in den Anpassungen einen „notwendigen Schritt, um den Industriestandort Deutschland nicht zu überfordern“. Sie betonen, dass der Kontrollaufwand gerade bei kleineren ausländischen Zulieferern unverhältnismäßig, wenn nicht sogar unmöglich sei.
Negative Reaktionen: Sorge um Menschenrechte und Transparenz
Ein breites Bündnis aus NGO, Gewerkschaften und Kirchen reagiert hingegen schockiert auf die geplanten Änderungen und spricht von einer dramatischen Entkernung des Gesetzes.
Die Hilfsorganisation Oxfam Deutschland kritisiert, dass „ohne Berichtspflichten und klare Sanktionen das Gesetz ein Papiertiger bleibt“. Die Reform sende das Signal aus, dass Menschenrechte nachrangig gegenüber Wirtschaftsinteressen seien. Die Initiative Lieferkettengesetz, ein Bündnis aus über 140 Organisationen, bezeichnet die Reform als „fatalen Rückschritt“. Die Abschaffung der Berichtspflichten würde die öffentliche Kontrolle der Umsetzung faktisch beenden, da „ohne Transparenz keine Verantwortung“ möglich sei.
NGO befürchten, dass die Abschwächung ein völlig falsches Signal sende, da bereits der bestehende Rechtsrahmen nicht ausreichend gewesen sei. Gewerkschaften und Kirchen bangen um den Arbeitsschutz in globalen Lieferketten und fordern, dass Arbeiterrechte und Umweltstandards nicht für die Wettbewerbsfähigkeit geopfert werden dürfen.
Wie geht es weiter? Der Gesetzgebungsprozess
Die weiteren Schritte im Gesetzgebungsprozess sind klar getaktet:
- Oktober und November 2025: Es sind Anhörungen von Experten (u.a. von SPD, Grünen und NGO) in den zuständigen Ausschüssen geplant, um die Argumente detailliert abzuwägen.
- Dezember 2025: Der Bundesrat soll sich mit der Vorlage befassen, bevor im selben Monat die Verabschiedung und Veröffentlichung erfolgen soll, um ein Inkrafttreten im nächsten Jahr zu ermöglichen.
Eine mögliche Blockade könnte noch von Grünen und SPD-Abgeordneten ausgehen. Zudem könnte die EU-Kommission einschreiten, falls die Abschwächung des LkSG als Verstoß gegen den Sinn und Zweck der CSDDD-Richtlinie gewertet wird.
Parallel läuft diese Auseinandersetzung auch auf EU-Ebene und dürfte ihrerseite Einfluss auf den deutschen Gesetzgebungsprozess haben. Am 13. Oktober har sich das EU-Parlament auf einen Kompromiss zu CSRD und CSDDD geeinigt, der nun im Plenum des EU-Parlaments beraten werden soll. Damit sollen die beiden zentralen Nachhaltigkeitsgesetze der EU vereinfacht und praktikabler gestaltet werden.
Die CSDDD soll künftig für Unternehmen mit mindestens 5.000 Mitarbeitenden und 1,5 Mrd. € Umsatz gelten, während die CSRD für Firmen ab 1.000 Mitarbeitenden oder 450 Mio. € Umsatz greifen soll. Der Kompromiss steht für den neuen Kurs in Brüssel: Weniger Komplexität, mehr Proportionalität. Die Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments folgt in Kürze.
Die politische Auseinandersetzung um die Balance zwischen unternehmerischer Entlastung und globaler Sorgfaltspflicht bleibt somit hochspannend.
Auswirkungen auf die Unternehmens-Compliance
Obwohl die Novelle die Unternehmen insbesondere durch den Wegfall formaler Berichtspflichten entlasten soll, bleiben die Sorgfaltspflichten des LkSG in vollem Umfang bestehen. Hier eine Übersicht, was das für Unternehmen bedeutet:
| Geplante Änderung | Compliance-Auswirkung |
| Wegfall der externen Berichtspflicht (§ 10 Abs. 2 LkSG) | Entlastung von Bürokratie: Unternehmen müssen keine jährlichen Berichte mehr erstellen und beim BAFA einreichen, was administrative Kosten senkt. |
| Beibehaltung der Dokumentationspflicht | Kontinuität: Die Durchführung der Sorgfaltspflichten (Risikoanalyse, Präventions- und Abhilfemaßnahmen, Beschwerdeverfahren) muss weiterhin intern umfassend dokumentiert werden, da diese Dokumentation die Grundlage für Kontrollen durch das BAFA bildet. |
| Reduzierung der Sanktionen auf schwere und systematische Verstöße (insbesondere bei menschenrechtlichen Risiken) | Fokusverschiebung: Die Compliance-Anstrengungen müssen sich noch stärker auf die wirksame Prävention und unverzügliche Abhilfe bei tatsächlichen oder drohenden schweren Menschenrechtsverletzungen konzentrieren. |
Die Entlastung betrifft primär die formale Berichterstattung, nicht die inhaltliche Umsetzung des Risikomanagements. Die Kernpflichten wie die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens, die Durchführung der Risikoanalyse und die Verankerung von Präventions- und Abhilfemaßnahmen bleiben bestehen und sind weiterhin bußgeldbewehrt (wenn auch enger gefasst).
Wenn Sie sich schon jetzt über die Auswirkungen auf ihr Compliance-Management-System informieren möchten, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.